Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
Hier beginnt der Hauptinhalt dieser Seite
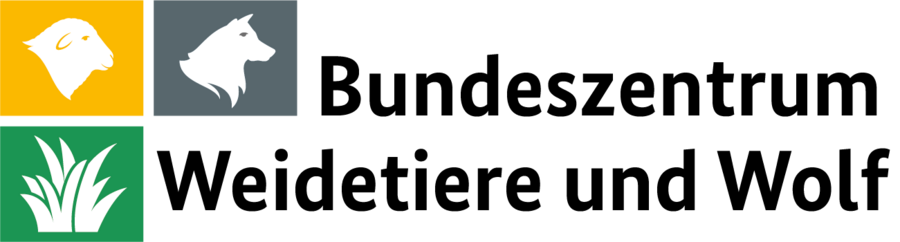
Ja. Denn die Wölfe haben sich hierzulande schon in vielen Regionen angesiedelt. Selbst in Gebieten ohne ansässige Wolfsrudel können durchziehende Wölfe Übergriffe auf Nutztiere verüben.
Es gibt allerdings Gegenden, in denen sich Herdenschutzzäune schwer aufbauen lassen oder nicht aufgestellt werden dürfen. Dazu gehören etwa bergiges Gelände oder Deiche. Hier können andere Herdenschutzmaßnahmen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Herdenschutzhunde und/oder eine Behirtung. Auch die gezielte Entnahme von schadstiftenden Wölfen kann helfen.
Es gibt bei Weidezäunen zwei Arten der Barrierewirkung:

Der gesamte Stromfluss am Elektrozaun – und damit die Abschreckung von Wölfen – funktioniert nur, wenn der Stromkreis geschlossen ist. Doch ohne Erdung bleibt der Stromkreis geöffnet, auch wenn der Zaun berührt wird. Somit fließt kein Strom und es gibt keinen Stromschlag.
Bei vorhandener, aber unzureichender Erdung ist der Stromschlag nur schwach. Manchmal reicht er nicht aus, um Wölfe abzuschrecken.
Die Barrierewirkung eines elektrischen Herdenschutzzauns entsteht durch den Schmerz bei der Berührung. Dafür spielt der funktionierende Stromkreis die wichtigste Rolle, nicht die Zaunhöhe.
Welche Höhe vorgeschrieben ist, richtet sich nach der Tierart und den Anforderungen für die Ausbruchssicherheit. Für Schafe und Ziegen muss ein Elektro-Herdenschutzzaun in der Regel 90 cm hoch sein. Detaillierte Angaben finden Sie in unserer Broschüre (Link folgt in Kürze).
Einsprunghilfen schaffen Erhöhungen, von denen aus Wölfe über den Zaun in die Weide blicken und springen können. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese zu entschärfen:
Leider sind diese Möglichkeiten für kleine Flächen und in bestimmten Gegenden schwer umsetzbar.

Früher wurde empfohlen, Elektrofestzäune auch dann permanent unter Strom zu halten, wenn keine Weidetiere vorhanden sind. Damit wollte man verhindern, dass Wölfe das Queren der Zäune erlernen. Diese Idee ist aber weder wissenschaftlich evaluiert noch wirtschaftlich und praktikabel.
Ohne Strom und mit offenen Toren können sowohl Wölfe als auch andere Wildtiere die gezäunten Flächen problemlos queren. Das ist aus Sicht des Naturschutzes vorteilhaft.
Bereits kurz vor der erneuten Beweidung sollte der Zaun wieder unter ausreichende Spannung gesetzt werden.
Viermal im Jahr aktuelle Infos zu Weidetierhaltung, Herdenschutz und Wolf.
Noch Fragen, Anregungen, Kritik?