Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
Hier beginnt der Hauptinhalt dieser Seite
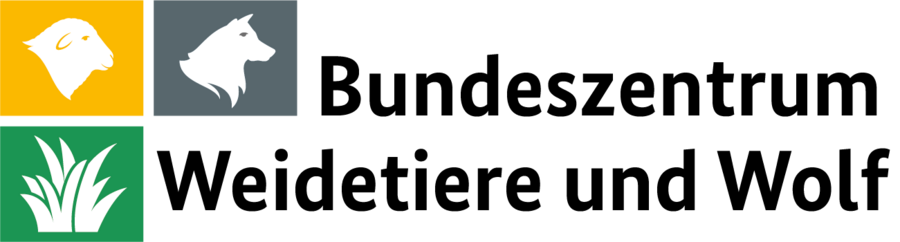

Die Weidetierhaltung nimmt eine Schlüsselrolle bei der Pflege und Erhaltung von Ökosystemen wie Heide- und anderen Offenland-Kulturlandschaften, bei der Erhaltung alter seltener Nutztierrassen sowie (im Falle der Deichschäferei) beim Küstenschutz ein.
Die Weide dient vielen Schafen, Ziegen oder Rindern als Nahrungsgrundlage. Gleichzeitig halten die Weidetiere damit viele Landschaften in Deutschland offen. Das bedeutet: Diese Gegenden verbuschen nicht und dienen weiter als vielseitige Kulturlandschaften. Doch was genau sind die Vorzüge der Haltung von Weidetieren?
Weidetiere erzeugen nachhaltig Fleisch, Milch und Wolle auf den Weiden. Denn durch das Weiden verwerten die sogenannten Wiederkäuer für den Menschen nicht nutzbare Nährstoffe (vor allem in Form von Gras).
Schafe pflegen mit ihrem Biss und Tritt Deiche besser, als es Maschinen könnten. Sie betreiben aktiven Küsten- und Hochwasserschutz in Deutschland. Außerdem lassen sich schwierig erreichbare Gebiete (etwa in den Bergen) am besten mit trittfesten Weidetieren landwirtschaftlich nutzen.
Auf Weiden ist die Artenvielfalt an Gräsern, Kräutern und Insekten besonders hoch. Die Exkremente der Weidetiere dienen als Nährstoffquelle für viele Insenkten und als Dünger für die Pflanzenwelt. Insbesondere Schafe werden gern als „Samentaxi“ bezeichnet: Über Fell, Hufe und Kot transportieren sie Pflanzensamen und Kleintiere, was die genetische Vielfalt fördert.
Teilweise gefährdete Kulturlandschaften wie Magerrasen oder Bergwiesen bleiben nur durch die Beweidung mit Nutztieren erhalten.
Auch die Statistik beweist die große Bedeutung von Weidetieren in Deutschland:
* in Betrieben ab 20 Tieren.
** in Betrieben ab 10 Tieren.

Seit Ende der 1990er-Jahre wanderten die zuvor ausgerotteten Wölfe von Osten her wieder nach Europa ein. Sie konnten sich ungehindert in Deutschland vermehren und durften nicht bejagt werden, da ihre Art europarechtlich streng geschützt war.
Das Beuteschema der Raubtiere umfasst nicht nur Wild, wie Rehe und Hirsche, sondern auch Weidetiere. In Deutschland und vielen weiteren europäischen Ländern kommt es zunehmend und regelmäßig zu Übergriffen von Wölfen auf Weidetiere. Dabei töten und verle tzen die Beutegreifer viele Schafe, Rinder und Pferde.
Die aktuellen Daten der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) für 2024 ergaben über 1100 amtlich nachgewiesene Übergriffe von Wölfen auf Weidetiere. Dabei wurden 4300 Tiere getötet und verletzt. Insbesondere in den Gebieten, wo sich viele Wölfe aufhalten, ist das Risiko eines Übergriffs hoch.
2024/2025 gab es hierzulande 1.633 Wölfe.
(Zur Berechnung: Die Zahlen in der BZWW-Infografik beruhen auf der jährlichen Veröffentlichung der DBBW (Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf). Die DBBW erfasst Rudel, Paare und Einzeltiere. Für die durchschnittliche Rudelstärke hat das BZWW den Faktor 7 angesetzt. Diese Vorgehensweise orientiert sich an Mittelwerten wissenschaftlicher Publikationen und Statusberichte.)
Bisher mussten Weidetierhaltende ihre Tiere durch einen Zaun vor dem Ausbruch sichern. Diese sogenannte Weidesicherheit war den Bedürfnissen der unterschiedichen Tiere (Schafe, Rinder oder Pferde) angepasst.
Durch die starke Verbreitung und dem Schutzstatus der Wölfe sind Weidetiere heute fast überall in Deutschland gefährdet, von den Raubtieren gerissen zu werden. Um Wölfe von einem Übergriff auf eine Herde abzuhalten, reichen die Anforderungen an die übliche Weidesicherheit nicht mehr aus.
Um Wölfe möglichst fernzuhalten, müssen Weidetierhaltende zusätzlich höhere und stärker elektrifizierte Zäune bauen beziehungsweise Herdenschutzhunde zur Verteidigung anschaffen. Dieser sogenannte Herdenschutz erhöht jedoch stark den personellen und finanziellen Aufwand der Tierhalter.
Dazu kommt: Nicht immer und überall wirkt der Herdenschutz gegen Wölfe. Auch ist Herdenschutz nicht in jeder Region möglich und zumutbar. Viele Weidetierhaltende stehen in der Praxis vor großen Schwierigkeiten, wenn sie ihre Tiere wirksam schützen wollen.
In Deutschland gilt seit Mitte 2025 in fast allen Regionen erstmals ein „günstiger“ Erhaltungszustand für den Wolf. Da der Schutzstatus des Wolfs in der Berner Konvention zum 7. März 2025 von „besonders geschützt“ auf „geschützt“ herabgestuft wurde, wird er in Deutschland 2026 in das Bundesjagdgesetz (BJagdG) aufgenommen.
Oberste Priorität hat weiterhin ein praxistauglicher und finanzierbarer Herdenschutz. Dieser besteht aus dem Bau von Herdenschutzzäunen, dem Einsatz von Herdenschutzhunden sowie der Entnahme von Wölfen. Länder in Regionen mit hoher Wolfsdichte und günstigem Erhaltungszustand sollen zukünftig ein Bestandsmanagement einführen.
Wenn Wölfe Herdenschutzmaßnahmen überwinden, sollen sie rechtssicher entnommen werden können. In Gebieten, in denen Herdenschutz durch Zäune oder Hunde unzumutbar ist – etwa in Teilen der alpinen Region –, soll eine Entnahme zur Vermeidung von Weidetierrissen ebenfalls möglich sein.
Der Bund unterstützt die Bundesländer bei der Finanzierung von Herdenschutzmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK). Bedingt durch das föderale System, gibt es in Deutschland ein komplexes Geflecht aus Förderungen rund um den Herdenschutz und aus Regelungen rund um den Schadensausgleich für gerissene Tiere.
Viermal im Jahr aktuelle Infos zu Weidetierhaltung, Herdenschutz und Wolf.
Noch Fragen, Anregungen, Kritik?