Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
Immer mehr Landwirtinnen und Landwirte setzen auf Zwischenfrüchte. Denn der Zwischenfruchtbau hat viele pflanzenbauliche Vorteile, die zugleich auch der Umwelt zugutekommen: Zwischenfrüchte versorgen den Boden mit organischer Substanz und erhöhen die Bodenfruchtbarkeit. Sie vermindern unerwünschte Effekte wie Bodenerosion und Nährstoffaustrag und sorgen dafür, dass der Unkrautdruck reduziert wird.
Viele Ackerbäuerinnen und Ackerbauern, die Felder in den trockeneren Regionen Deutschlands haben, stehen dem Zwischenfruchtanbau allerdings noch skeptisch gegenüber. Sie haben Sorge, dass der Zwischenfruchtbau auf Kosten ihrer Hauptfrucht geht. Schließlich ist die Zwischenfrucht eine zusätzliche Kultur, die Wasser braucht. Und Trockenheit ist, wie die letzten Jahre eindrücklich gezeigt haben, nicht mehr bloß eine Gefahr für jene Gebiete, die seit jeher damit zu kämpfen hatten. Klimamodellen des Deutschen Wetterdienstes zufolge wird die Anzahl der trockenen Tage in Zukunft weiter zunehmen.
Die Universität für Bodenkultur Wien konnte in langjährigen Versuchen zeigen, dass der Zwischenfruchtbau in trockenen Gebieten keine negative Ertragswirkung auf die Hauptfrucht hat. Die Wissenschaftler führten in typischen Trockengebieten Österreichs – mit einem durchschnittlichen Jahresniederschlag von 594 mm – Versuche an den Kulturen Zuckerrübe, Körnermais und Sommergeste durch.
Das Ergebnis ist eindeutig: 73,5 Prozent aller Ackerschläge mit Sommergerste, 80,7 Prozent aller Schläge mit Zuckerrübe und 85,1 Prozent aller Schläge mit Körnermais zeigten keine Ertragsreaktionen durch den Zwischenfruchtbau. Das heißt, egal ob vor einer Kultur Schwarzbrache oder eine Zwischenfrucht stand: Auf den Ertrag der Hauptkultur hatte es keinen Effekt.
Selbst in ausgewiesenen Trockenjahren hatte der Zwischenfruchtbau keine negative Ertragsreaktion auf die Hauptkultur. Bei Zuckerrüben lagen die Erträge nach dem Zwischenfruchtbau in Trockenjahren sogar tendenziell höher als nach Schwarzbrache.
Um den Einfluss der Zwischenfrucht auf den Wasserhaushalt besser zu verstehen, muss man den gesamten Wasserkreislauf im Blick haben. Dieser beschränkt sich nicht allein auf die Transpiration, das heißt den Wasserentzug des Pflanzenbewuchses. Es gibt weitere Komponenten, die von der Zwischenfrucht beeinflusst werden – und zwar im positiven Sinne. Dazu zählen die Evaporation, also die Verdunstung über die unbedeckte Bodenoberfläche, der Oberflächenabfluss, die Wasserspeicherfähigkeit sowie die Sickerwassermenge.
Im Vergleich zur Schwarzbrache verdunstet durch den Zwischenfruchtbau bedeutend weniger Wasser über die Bodenoberfläche. Das ist einleuchtend, weil der Boden ja die meiste Zeit mit Pflanzen oder Mulch bedeckt ist. Doch auch der Gesamtwasserverlust, das heißt der Verlust aus Transpiration (über die Pflanzenoberfläche) und Evaporation (über die Bodenoberfläche) – in Fachkreisen Evapotranspiration genannt – ist beim Zwischenfruchtbestand geringer als der reine Wasserverlust über Evaporation bei einer Schwarzbrache (siehe Tabelle).
| Varianten | Jahr | Schwarzbrache | Phacelia | Winterwicke | Grünroggen | Gelbsenf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpiration | 2004 | 0 | 36,2 | 18,6 | 23,4 | 79,6 |
| 2005 | 0 | 19,5 | 33,7 | 32,7 | 42,2 | |
| Evaporation | 2004 | 133,7 | 71,8 | 81,0 | 102,4 | 53,0 |
| 2005 | 93,7 | 77,7 | 55,8 | 75,8 | 63,5 | |
| Evapotranspiration | 2004 | 133,7 | 108,0 | 99,6 | 125,8 | 132,6 |
| 2005 | 93,7 | 97,2 | 89,5 | 108,5 | 105,7 |
Verdunstung durch Pflanzen (Transpiration) und Verdunstung über den Boden (Evaporation) bei Schwarzbrache und Zwischenfrüchten. Die Werte (Millimeter Wasser pro Quadratmeter Fläche) stellen errechnete Werte auf Basis von Wasserbilanzmessungen dar.
Quelle: Gernot Bodner
Die ständige Bodenbedeckung durch Pflanzen oder Mulch bewirkt, dass der Oberflächenabfluss in hängigem Gelände bei Zwischenfruchtkulturen sehr viel geringer ist als auf Schwarzbrachen. Die Untersuchungen der Universität Wien zeigen: Wenn 50 Prozent der Bodenoberfläche mit Pflanzen oder Mulch bedeckt sind, kann der Oberflächenabflusses um etwa 80 Prozent gesenkt werden.
Böden mit einer geringen Profiltiefe und leichte Standorte können nur einen Teil der Winterfeuchte speichern, der Rest geht meist als Sickerwasser ins Grundwasser verloren. Der Zwischenfruchtbau hilft gerade bei solchen Böden, die Sickerwasserverluste zu minimieren. Das funktioniert, weil Humus angereichert und dadurch die Bodenstruktur verbessert wird. Versuchsergebnisse der Uni Wien belegen, dass nach dem Zwischenfruchtbau das Porenvolumen des Bodens im Vergleich zur Schwarzbrache um bis zu 15 Prozent höher ist. Dabei nehmen sowohl die für die Regenverdaulichkeit wichtigen Grobporen als auch die für die Wasserspeicherung bedeutenden Mittelporen zu.
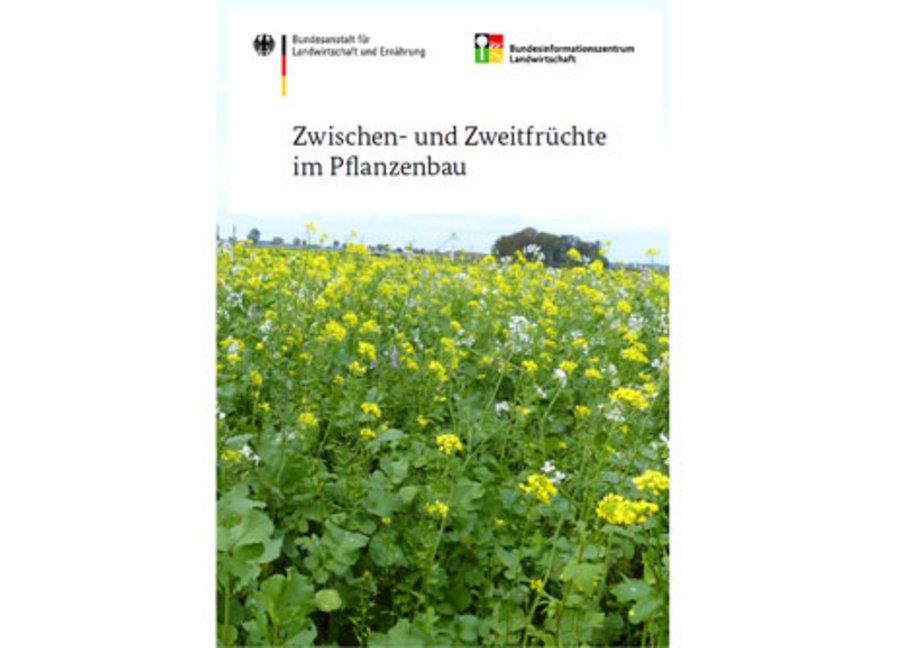
Die eigentlich vegetationslose Zeit mit Zwischen- und Zweitfrüchten zu nutzen, hat viele Vorteile: Sie verbessern den Boden durch verbleibende Pflanzenreste auf dem Acker. Außerdem schützen sie Umwelt und Gewässer, weil durch sie Bodenerosion und Nährstoffaustrag vermindert und Biodiversität erhöht wird
Die Wassernutzungseffizienz – das heißt, das Verhältnis von fixiertem Kohlenstoff zu transpiriertem Wasser einer Pflanze – ist bei Zwischenfrüchten meist höher als bei Hauptfrüchten. So beträgt zum Beispiel die Wassernutzungseffizienz der Zwischenfrucht Senf etwa 4 Gramm Trockenmasse je Liter verbrauchtem Wasser und liegt damit um etwa 40 Prozent höher als die von Raps. Grund dafür ist in erster Linie die Tatsache, dass Zwischenfrüchte und Hauptkulturen zu unterschiedlichen Jahreszeiten kultiviert werden. So ist ein geschlossener Zwischenfruchtbestand im Herbst entsprechend wassereffizient.
Bei einer winterharten Begrünung kommt es bereits frühzeitig zu einer Austrocknung der oberen Bodenschichten, sobald im Frühjahr die Transpiration einsetzt. Bei einer abfrierenden Zwischenfruchtbegrünung reduzieren dagegen die Pflanzenrückstände an der Bodenoberfläche die Bodenverdunstung. Allerdings ist zu beachten: Die höheren Wassergehalte im Oberboden führen auch dazu, dass sich der Boden im Frühjahr langsamer erwärmt.
Zwischenfrüchte verbrauchen bei einer Vegetationszeit von Mitte August bis Mitte Dezember etwa 120 mm Wasser. Von diesem Wasserverbrauch können bis zu 60 Prozent über unproduktive Bodenverdunstung verloren gehen, wenn die eingesäte Kultur den Boden nicht rasch abdeckt. Denn gerade im verdunstungsintensiven Spätsommer geht das meiste Wasser verloren. Besonders bei Trockenheit ist es daher wichtig, über die Wahl geeigneter Pflanzenarten und -sorten, sowie angepasste Sätechnik für eine schnelle Etablierung des Zwischenfruchtbestandes zu sorgen.
Letzte Aktualisierung: 27.09.2023