Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
Hier beginnt der Hauptinhalt dieser Seite
Der Anbau der Multitalente hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Das liegt vor allem daran, dass der Zwischenfruchtbau neben dem Anbau von Leguminosen bei Landwirtinnen und Landwirten eine beliebte Maßnahme war, um den bis Ende 2022 geltenden Greening-Verpflichtungen der EU nachzukommen. Auch im Rahmen der ab 2023 geltenden Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) spielen der Anbau von Zwischenfrüchten und damit verbundene Vorteile eine wichtige Rolle. Durch den Einsatz in der Praxis ist mittlerweile nämlich klargeworden: Es gibt mehr als nur förderpolitische Gründe, Zwischenfrüchte anzubauen.
Mit Zwischenfrüchten können nämlich die sonst vegetationslosen Zeiträume im Jahresverlauf genutzt werden. Die dabei auf dem Acker verbleibenden Pflanzenreste versorgen den Boden mit organischer Substanz. Zwischen- und Zweitfrüchte tragen außerdem zum Umwelt-, Boden- und Gewässerschutz bei, denn sie vermindern unerwünschte Effekte wie Bodenerosion und Nährstoffaustrag.
Je nachdem, ob man mit den Zwischenfrüchten nur den Spätsommer und Herbst oder zusätzlich den gesamten Winter überbrückt, unterscheidet man zwischen Sommer- und Winterzwischenfruchtbau.
Zu den Sommerzwischenfrüchten zählen alle Kulturen, deren Hauptwachstumszeit im Spätsommer/Herbst liegt und die vor dem Winter abgeerntet werden oder im Spätherbst/Winter absterben. Sie nutzen also die Vegetationszeit, die nach der Ernte der Hauptkultur (zum Beispiel Getreide, Körnererbsen, Frühkartoffeln) bis zur Vegetationsruhe im Spätherbst zur Verfügung steht. Wachstum und Ertrag der Zwischenfruchtkultur sind dabei stark abhängig von der Witterung, der Länge der Vegetationszeit, vom Saattermin der Zwischenfrucht und der Saat der Folgekultur.
Winterzwischenfrüchte dagegen werden je nach Standort und Pflanzenart von Mitte August bis Ende September ausgesät und zwischen April und Mai geerntet. Der Anbau von Winterzwischenfrüchten ist relativ risikoarm: Die Winterfeuchtigkeit ist ausreichend hoch, so dass meist auf allen Bodenarten ein Anbau möglich ist. Je länger sich jedoch die Wachstumszeit der Zwischenfrucht ins Frühjahr hineinzieht, umso schwieriger werden Bodenbearbeitung und termingerechte Aussaat der Folgekultur.
Der Zweitfruchtbau – auch Zweikultursystem genannt – besteht aus einer Winterung, die im Frühjahr bzw. Frühsommer geerntet wird und einer darauffolgenden Zweitfrucht, die noch im gleichen Jahr erntereif wird. Auf diese Weise können zwei Ernten in einem Jahr erzielt werden.
Als Winterungen kommen zum Beispiel infrage: Welsches Weidelgras und Grünroggen oder Wintergetreide, das in der Milch- bis Teigreife als Ganzpflanzensilage für die Energiegewinnung geerntet wird. Je nach Vorfrucht folgt dann ab Mai oder Juni die Aussaat einer Zweitfrucht wie Silo- oder Energiemais, Sommergetreide oder Futterkohl.
Voraussetzung für das Gelingen des Zweitfruchtbaus ist, dass den gewählten Kulturen genügend Niederschlags- oder Bodenwasser zur Verfügung steht und die Vegetationszeit ausreichend lang ist.
Für die Anlage von Zwischenfruchtbeständen kommen verschiedene Verfahren zum Einsatz. Die Stoppelsaat ist das am häufigsten angewendete. Dabei werden die Zwischenfrüchte nach einer Hauptfrucht wie Körnergetreide oder Frühkartoffeln in einen mehr oder weniger tief bearbeiteten Boden – teilweise mit Strohresten oder -stoppeln auf der Bodenoberfläche – ausgesät. In seltenen Fällen wird der Boden zuvor mit dem Pflug gewendet – dann spricht man von Blanksaat.
Die Mindestvegetationsdauer für Zwischenfrüchte nach der Stoppelsaat beträgt sieben bis neun Wochen. Wird ein starker Aufwuchs für Futternutzung oder Bioenergie angestrebt, sind längere Wachstumszeiten erforderlich. Wichtig ist ein feinkrümeliges, rückverfestigtes Saatbett, das ausreichenden Bodenschluss und damit die Wasserzufuhr zum Saatkorn gewährleistet. Die Saatgutablage sollte mit der gleichen Genauigkeit und Exaktheit wie bei anderen Kulturen erfolgen.
Bei der Untersaat wird die Zwischenfrucht zusätzlich zu einer früher erntereifen Hauptfrucht (Deckfrucht) gesät. Dies kann beispielsweise bei Wintergetreide bereits im Herbst stattfinden oder erst im Frühjahr. Wird gleichzeitig mit der Deckfrucht ausgesät, spricht man von Beisaat.
Untersaaten haben gegenüber Stoppelsaaten einige Vorteile, sind in der Praxis jedoch noch wenig akzeptiert. Viele Landwirte befürchten, dass zu hoch gewachsene Untersaaten die Entwicklung der Hauptfrucht beeinträchtigen und die Ernte erschweren. Bei Verwendung geeigneter Arten und Sorten sowie angepassten Saatterminen sind solche Probleme jedoch nicht zu erwarten.
Auch die viel diskutierte Konkurrenz zwischen Untersaat und Deckfrucht um das Wasser ist bei sachgerechter Einbringung der Untersaat nicht zu befürchten. Ebenso stellt die chemische Regulierung der Unkräuter und Ungräser in der Deckfrucht kein grundsätzliches Problem für die Etablierung von Untersaaten dar.
Zwischenfrüchten steht meist nur eine kurze Entwicklungszeit mit ausreichenden Temperaturen zur Verfügung, weshalb rasche Keimung und Jugendentwicklung Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen Anbau sind. Leichte und mittlere Böden lassen sich schnell und einfach bearbeiten und sind daher gegenüber schweren, tonigen Böden klar im Vorteil. Auf leichten Böden mit hohem Sandanteil sollte man Arten auswählen, die gut an Trockenheit angepasst sind: Geeignet sind zum Beispiel Sand- oder Rauhafer für den Sommerzwischenfruchtbau und Wickroggen, Grünroggen oder Zottelwicke für den Winterzwischenfruchtbau.
Wer auch auf schweren, tonigen Böden nicht auf Zwischenfrüchte verzichten möchte, sollte Untersaaten den Stoppelsaaten vorziehen, weil hiermit ein Wachstumsvorsprung erzielt werden kann. In diesem Fall beschränkt sich das verfügbare Artenspektrum allerdings auf untersaatgeeignete Gräser und Kleearten, deren Lichtansprüche nicht zu hoch sein dürfen.
Will man mit dem Zwischenfruchtbau den gesamten Winter überbrücken, muss man auf entsprechend winterharte Arten zurückgreifen. Das trifft nur auf relativ wenige Zwischenfruchtarten zu. Die Auswahl für den Sommerzwischenfruchtbau ist dagegen schon größer (siehe Seite 11 und 12 in der BZL-Broschüre „Zwischen- und Zweitfrüchte im Pflanzenbau“).
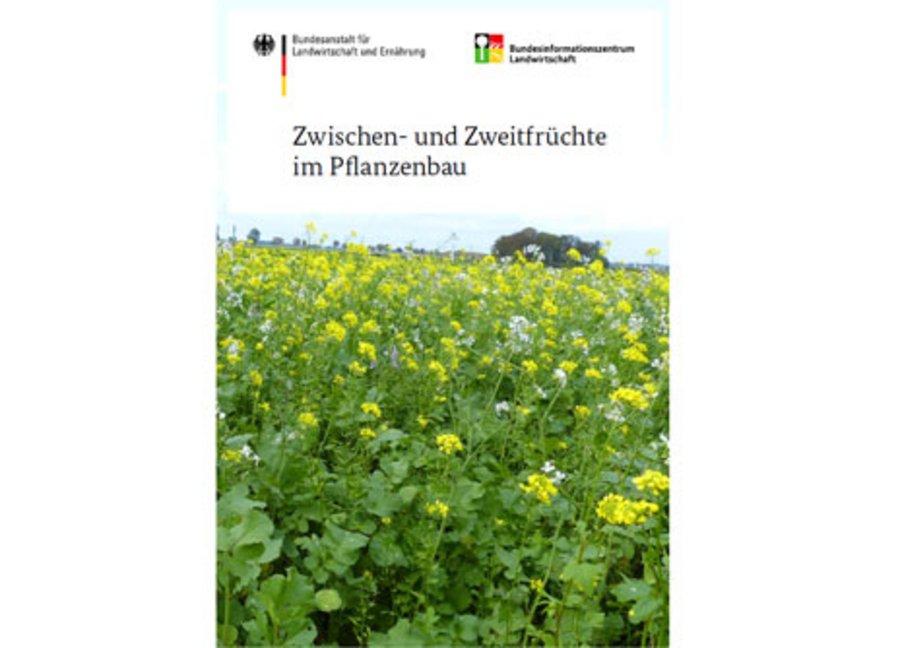
Die eigentlich vegetationslose Zeit mit Zwischen- und Zweitfrüchten zu nutzen, hat viele Vorteile: Sie verbessern den Boden durch verbleibende Pflanzenreste auf dem Acker. Außerdem schützen sie Umwelt und Gewässer, weil durch sie Bodenerosion und Nährstoffaustrag vermindert und Biodiversität erhöht wird
Insbesondere beim Anbau von Sommerzwischenfrüchten sollte auf eine frühestmögliche Aussaat geachtet werden, um die kurze Vegetationszeit bis zum Herbst möglichst gut ausnutzen zu können. Hier gilt grundsätzlich die Faustregel: Ein Tag im Juli ist besser als eine Woche im August. Eine Woche im August ist besser als der ganze September.
Die Saatzeitansprüche der verschiedenen Arten und Sorten sind teilweise sehr unterschiedlich. So müssen saatzeitempfindliche Arten wie Gräser, Klee oder Grobleguminosen möglichst früh ausgesät werden (bis Ende Juli). Spätsaatverträgliche Arten wie Raps, Senf oder Ölrettich vertragen dagegen auch spätere Aussaaten – dann allerdings mit verzögerter Entwicklung und geringerer Trockenmassebildung.
Die Auswahl der Art ist immer auch an den Standort anzupassen: So eignen sich einige besonders wärmeliebende Arten wie Sudangras, Esparsette, Bockshornklee und Alexandrinerklee nicht für den Anbau in kühleren Regionen. Andere reagieren wiederum empfindlich auf Trockenheit, wie Welsches Weidelgras, Felderbse, oder Schwedenklee. In Gebieten mit kurzer Vegetationszeit bieten sich Untersaaten an, um den Pflanzen einen Wachstumsvorsprung zu gewähren.
Unbedingt zu beachten ist auch, dass „Infektionsbrücken“ vermieden werden. So sollte zum Beispiel nach Raps keine kreuzblütige Zwischenfrucht wie zum Beispiel Senf angebaut werden, um der Kohlhernie vorzubeugen. Besonders zu achten ist darauf bei artenreichen Zwischenfruchtmischungen.
Der Saatgutmarkt bietet mittlerweile Zwischenfrüchte und Zwischenfruchtmischungen für verschiedenste Einsatzbereiche.
Letzte Aktualisierung: 27.09.2023