Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
Hier beginnt der Hauptinhalt dieser Seite
Bunte Farbkleckse im Frühjahr, üppige Blütenfülle und sanft wogende Gräser im Sommer, ein spektakuläres Finale im Herbst und abwechslungsreiche Strukturen im Winter: Staudenbeete, die rund ums Jahr eine Augenweide sind, stehen auf der Wunschliste vieler Gartenbesitzer und Stadtplaner ganz oben. Dennoch überwiegen insbesondere in städtischen oder gewerblichen Grünanlagen meist Monokulturen bodendeckender Gehölze wie Zwergmispel (Cotoneaster) oder Strauch-Fingerkraut (Potentilla fruticosa).
Staudenpflanzungen haftete lange Zeit der Ruf an, ausgesprochen pflege- und entsprechend kostenintensiv zu sein. Tatsächlich können Staudenpflanzungen viel Arbeit machen –müssen sie aber nicht. Im Gegenteil: An zahlreichen gartenbaulichen Lehr- und Versuchsanstalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden in den vergangenen Jahren ausgeklügelte Pflanzkonzepte entwickelt, die den Pflegeaufwand für Staudenpflanzungen innerhalb kurzer Zeit auf ein Minimum senken.
Der Grundgedanke: Staudenpflanzungen als sich weitgehend selbstregulierende Systeme begreifen, in denen der Erhalt der Pflanzung als Ganzes im Mittelpunkt steht, nicht der einzelner Arten. Zu diesem Zweck sind die in den Mischungen enthaltenen Pflanzenarten und -sorten in ihrem Wuchsverhalten und ihren Standortansprüchen sorgfältig aufeinander abgestimmt. So dienen beispielsweise in den ersten Jahren nach der Pflanzung kurzlebige Füllstauden als attraktive Blickfänge und Unkrautunterdrücker, die sich aber bereitwillig verdrängen lassen, sobald sich die Akzente setzenden Gerüststauden und ihre Begleiter etabliert haben.
Ähnlich anpassungsfähig sind die zum Einsatz kommenden langlebigen Bodendeckerstauden, die Lücken zwischen hohen und halbhohen Arten dauerhaft schließen und somit der Spontanvegetation entgegenwirken. Dafür ziehen sie sich zurück, falls die höheren Arten mehr Platz benötigen. Durch diese kontrollierte Dynamik werden regulierende Eingriffe wie Teilen oder Ausdünnen nahezu überflüssig.
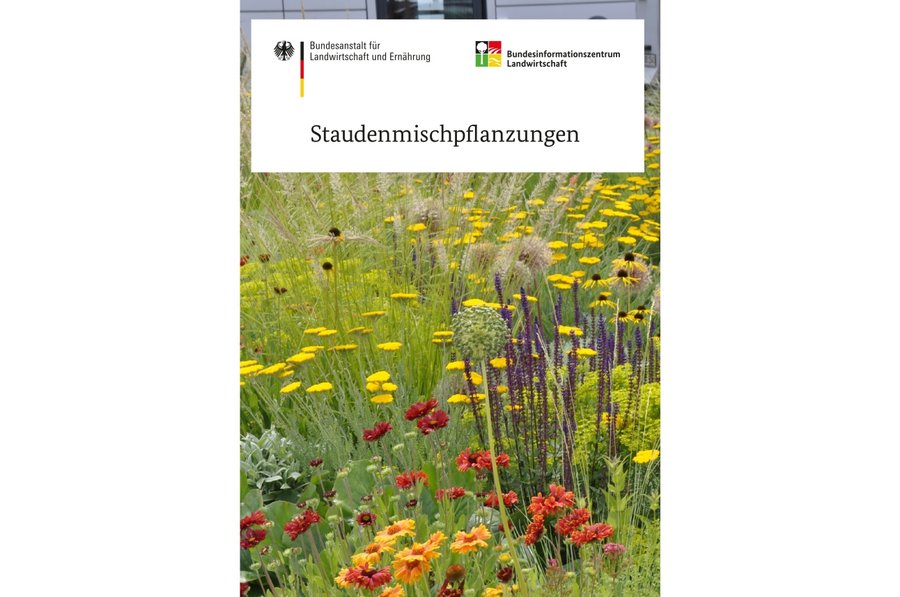
Die Broschüre stellt 32 erprobte Mischpflanzungen vor, die nur wenig Pflege benötigen und ganzjährig attraktiv aussehen. Für jede Mischung gibt es eine ausführliche Pflanzenliste und zusätzlich Grundlagentexte zu Planung, Gestaltung, Anlage und Pflege von Staudenbeeten.
Die in den Schau- und Versuchsgärten erfolgreich erprobten Mischungen, von denen jede im Schnitt 15 bis 20 unterschiedliche Pflanzenarten und -sorten enthält, gibt es mittlerweile in über 36 verschiedenen Varianten für die unterschiedlichsten Standortvoraussetzungen. Dabei gilt: Je extremer ein Standort, desto geringer der Pflegeaufwand.
Auf einer trockenen Fläche mit nährstoffarmem Substrat beispielsweise kümmern eigentlich lästige Wurzelunkräuter wie Giersch (Aegopodium) oder Melde (Atriplex) vor sich hin, während Blütenschönheiten wie der leuchtend blaue Ausdauernde Lein (Linum perenne) oder der duftende, luftig-leichte Steinquendel (Calamintha nepeta ssp. nepeta) prächtig gedeihen.
An allen Standorten kann zudem eine Mulchschicht – mineralisch an sonnigen und trockenen Standorten, organisch auf frischen Böden im Schatten – auf ästhetische Weise zur Unkrautunterdrückung in der Anwachsphase beitragen.
Entscheidend für den Erfolg jeder Pflanzung sind somit die Wahl der passenden Staudenmischung, die Bodenvorbereitung sowie die Pflege. Letztere besonders in den ersten Jahren, bis sich die Pflanzendecke geschlossen hat. Schon während dieser Zeit halten sich die Arbeiten allerdings in Grenzen: Zwar müssen gelegentlich mal ein paar Unkräuter herausgezogen werden – Hacken ist tabu, da es das Aufkeimen neuer Unkräuter fördern würde – doch bereits das Wässern kann nach dem Jahr der Pflanzung eingestellt werden.
Da die verwendeten Pflanzen auch im Hinblick auf ihren Winteraspekt ausgesucht wurden, bleiben sie im Herbst stehen, damit sie der Raureif in glitzernde Skulpturen verwandeln kann. Der Rückschnitt mit Motorheckenschere und Balkenmäher erfolgt erst gegen Ende des Winters oder bei Wiesenmischungen im Sommer.
Letzte Aktualisierung 08.03.2024